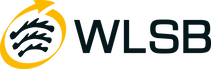Das Potenzial des organisierten Sports
Sportvereine sowie Sport- und Bewegungsstätten müssen deutlich mehr in die Stadt- und Quartiersentwicklung einbezogen werden. Sie sind Begegnungs- und Alltagsorte, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und das Miteinander und Zusammenleben in der Kommune positiv prägen. Wenn es darum geht, Quartiere sozial, inklusiv und altersgerecht zu entwickeln, sind ihre Expertise und ihr Engagement unverzichtbar.
Dieses Potenzial des organisierten Sports wird bisher nicht ausreichend genutzt. Oft kommen die Sport-vereine erst dann ins Spiel, wenn es einen Übungsleiter für bereits feststehende Angebote braucht – das ist natürlich zu spät. Die Vereine und deren Ehrenamtliche müssen frühzeitig in die kommunalen Entwicklungsprozesse einbezogen werden, damit sie diese verstehen und sich auch gerne daran beteiligen. Sonst besteht die Gefahr, dass Kommune und Sportverein nicht an einem Strang ziehen.
Eine gelungene Zusammenarbeit kann so aussehen wie in Lonsee, wo auf einem Vereinsgelände ein „Outdoor-Sportpark“ unter dem Motto Lonsee in Bewegung entstand. In enger Kooperation von Kommune und Verein entstand eine innovative Struktur, die vom Verein für Angebote im Bereich Gesundheit genutzt wird und gleichzeitig auch für alle Bürger frei zugänglich ist.

Gemeinsam agieren
Der organisierte Sport weiß natürlich, dass die Kommunen und deren Haushalte vor allerlei Herausforderungen stehen, die sich auf den Sport durch Kürzungen auswirken. Auch deshalb gibt es schon jetzt interessante Modelle, bei denen sich Kommune und Vereine nicht nur in einem Förderverhältnis befinden, sondern gemeinsame Akteure sind – zu beiderseitigem Nutzen. Auch im Bereich der Ganztagsschule kennen wir solche Modelle, wie zum Beispiel beim Dachverein Vereine in Remseck.
Im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule ab 2026 sind die Sportvereine bereits vielfältig aktiv, zum Beispiel im Bereich Kooperation Schule-Verein oder auch in der Betreuung mit Hilfe von Freiwilligendienstleistenden.
Auch der WLSB ist in diesem Bereich verstärkt aktiv. Auf Landesebene vernetzen wir uns mit den kommunalen Spitzenverbänden und dem Sozialministerium und bringen die Perspektive des organisierten Sports ein. Für kommunale Entwicklungsprozesse haben wir eine Kommunalanalyse entwickelt. Damit lässt sich der organisierte Sport in einer gesamten Kommune darstellen.
Investitionen in die Infrastruktur sind Investitionen in das soziale Miteinander
Würden Sport und Bewegungsförderung künftig stärker im Fokus der Politik stehen und würden mehr Investitionen in eine moderne und ertüchtigte Infrastruktur getätigt, so würden neben schönen Sportplätzen, Hallen, Bewegungsparks etc. viele positive Mehrwerte und Kollateraleffekte entstehen.
Tatsächlich gibt es aber einen bundesweiten Sanierungsstau von über 30 Milliarden Euro, denn eine Vielzahl der Sportstätten ist ganz einfach in die Jahre gekommen. Um diese Strukturen nachhaltig zu ertüchtigen, muss richtig viel Geld in die Hand genommen werden, aber natürlich sind das lohnende Ausgaben.
Investitionen in die Infrastruktur sind Investitionen in das soziale Miteinander, denn Sport und Bewegung bedeuten mehr Gemeinschaft und weniger Vereinzelung. Neben den positiven Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit fördern Sport und Bewegung mentale Stärke und Resilienz und beugen chronischen und psychischen Krankheiten sowie Stress vor.
Der Sportwissenschaftler Ansgar Thiel umschreibt das so: „Sport, körperliche Aktivität und Gesundheit hängen sehr eng zusammen. Es gibt meines Erachtens kein kostengünstigeres und effizienteres Mittel als körperliche Aktivität, sowohl mit Blick auf chronisch degenerative Erkrankungen, die sich im Alter häufig zeigen, als auch in Bezug auf die psychische Gesundheit. Das ist so gut empirisch erforscht, dass man sich fragt, warum nicht überall in Städten Bewegungsgelegenheiten für ganz junge bis ganz alte Menschen aufgebaut werden.“ (Hier nachzulesen)
Sport- und Bewegungsräume sind nicht nur Orte körperlicher Aktivität, sondern zugleich soziale Treffpunkte, die das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Menschen maßgeblich beeinflussen.
Soziale und ökologische Nachhaltigkeit
Wer von modernen Sportstätten spricht, muss auch davon sprechen, dass diese für alle Menschen zugänglich und erreichbar sind. Die Themen Barrierefreiheit und Zugang für Alle sind damit weitere wichtige Themen, auch im WLSB. Wir haben hierzu für unsere Sportvereine im Bereich Inklusion eine Handlungshilfe erarbeitet – eine Art Barrierecheck – mit dem die Sportvereine ihre Infrastruktur auf Barrieren hin untersuchen und einen Statuscheck absolvieren können.
Nicht zuletzt unter dem Aspekt der sozialen Nachhaltigkeit ist natürlich die Teilhabe aller Menschen und die Ermöglichung von Zugang zu bestehenden Sportstätten wichtig. Dabei können mitunter auch sehr kreative und offene Bewegungsmöglichkeiten durch die Initiative eines Sportvereins entstehen, wie das Beispiel aus Vollmaringen zeigt (Zum Artikel).
Zur Teilhabe gehört auch die Berücksichtigung aller Altersgruppen im Verein. Ist es immer so, dass ältere Menschen noch den Weg ins Vereinsheim oder zum sonntäglichen Lokalderby des Heimatvereins finden können? Kommen Menschen mit Rollator zum Sportplatz oder zum Stammtisch? Auch daran zu erinnern, hilft manchmal, um bei den Vereinen Verständnis zu wecken.
Neben der sozialen Nachhaltigkeit ist im Bereich Sportstätten natürlich auch die ökologische Nachhaltigkeit ein ganz wichtiges Thema. Der WLSB ist hierbei ein wichtiger Partner für die Sportvereine, wenn es darum geht, energieeffizient zu bauen oder zu sanieren. Im Angebot sind neben der klassischen Sportstätten-Bauberatung auch ein Umwelt-Check und eine Energieberatung. Auch im Verbund mit Wirtschaftspartnern können dabei zu technischen Fragen rund um LED-Beleuchtung, Photovoltaik oder auch Wassermanagement gute Lösungen angeboten werden.
FAZIT: In Zeiten knapper Finanz- und Flächenressourcen reicht es nicht mehr aus, die Sportstätten allein vom Bedarf eines Vereinsvorstands oder eines Abteilungsleiters her zu denken (Fußball=Kunstrasen, Handball=Dreifeldhalle etc.). Zusammenarbeit ist das Gebot der Stunde.
Gleichwohl bleiben die normierten Sportstätten so etwas wie das Rückgrat oder der USP des organisierten Sports. Mit Blick auf gesellschaftliche Veränderungen, die zunehmende Diversität von Zielgruppen sowie knapper werdende Flächen und Ressourcen braucht es allerdings zunehmend auch modernere, offenere und multifunktionalere Infrastruktur. Mehrfachnutzung und Multicodierung sind hier die Stichworte.
Wenn wir unsere Sportstätten künftig bedürfnis- und bedarfsorientierter planen und gestalten sowie nachhaltiger und energieeffizienter bauen und sanieren wollen, dann braucht es mehr Kooperation und Zusammenarbeit von Bund, Land und Kommune. Es braucht mehr Wissen über den Status Quo (Stichwort Sportstättenatlas) und es braucht wieder mehr beziehungsweise neue Sportentwicklungsplanungen in den Städten und Gemeinden – und das unter Einbeziehung der Sportvereine. Und es braucht vor allem
mehr Geld.

Im Dialog mit
Stefan Anderer
Welche Möglichkeiten hat der Sport, seinen Forderungen mehr Nachdruck zu verleihen? Wie können Sportvereine es schaffen, sich frühzeitig bei den Kommunen Gehör zu verschaffen?
Damit der Sport nicht nur in den Sonntagsreden vorkommt, braucht es tatsächlich permanente Präsenz und Lobbyarbeit. Auch wenn alle betonen, wie wichtig Sport und Bewegung sind, muss man den Entscheidern in Kommune, Land und Bund das leider immer wieder deutlich
machen. Das heißt auf kommunaler Ebene also, im Gespräch sein und bleiben, die Gemeinderäte für Themen und Anliegen gewinnen, Position beziehen, aktiv sein und sich in Prozesse einbringen. Wenn der Sportverein sich allein darauf verlässt, dass er doch viele Mitglieder und gute Angebote hat, wird es nicht ausreichen. So lapidar das klingen mag, aber „Tu Gutes und rede darüber“ oder Trommeln gehört zum guten Handwerk. Wer hier in der Vergangenheit aktiv war, wird das spüren und von einem funktionierenden, lokalen Netzwerk profitieren.
Was bedeutet es mittel- und langfristig für den Sport und seine Infrastruktur, wenn die milliardenschweren Defizite zwar bekannt sind, aber konkrete Strategien und Konzepte ausbleiben?
Im Rahmen des Entwicklungsplan Sport wurden dazu zahlreiche Maßnahmen erarbeitet und als Handlungsempfehlung formuliert. Auf Bundesebene ist das alles bekannt und adressiert.
Es fehlt nur an der entsprechenden Umsetzung, denn Sportstätten sind neben dem Personal die wichtigste Ressource des organisierten Sports. Wir haben kein Wissensdefizit, sondern einen Mangel an Umsetzung und fehlender finanzieller Unterfütterung auf Bundesebene. Denn die anstehenden Herausforderungen bei Bau, Sanierung und Energetik können nicht allein von den Kommunen bewältigt werden. Sollte es bei dem Thema bei politischen Lippenbekenntnissen bleiben, dann bröckelt bald nicht nur der Putz in Sporthallen von den Wänden, sondern es drohen schlimmere Szenarien.
In Ihrem Beitrag finden sich gleich mehrere Beispiele für gute Zusammenarbeit zwischen Verein und Kommune: Was können wir daraus lernen?
Die Zeiten für Allein-Lösungen und Einzel-Ansprüche sind vorbei. Es braucht in allen Bereichen Synergie, Effizienz und Gemeinsinn. Kooperation und Zusammenarbeit beginnt dabei immer mit Kommunikation. Deshalb plädieren wir stets dafür, bei allen kommunalen Entwicklungsprozessen die Sportvereine von Anfang an mit ins Boot zu holen und zu Beteiligten zu machen. Dann gelingt vieles, wie in den Beispielen aufgezeigt, deutlich besser.
Welche Art von Sportstätten halten Sie angesichts der Individualisierung des Sports und des finanziellen und ökologischen Drucks für zukunftsfähig?
Es wird Sportstätten brauchen, die vielerlei Interessen bedienen und gerecht werden. Das bedeutet multifunktionale Sportanlagen für unterschiedliche Sportarten und Aktivitäten, die breitere Zielgruppen ansprechen und damit besser ausgelastet werden. In Bauweise und Betrieb müssen diese Anlagen energieeffizient und ressourcenschonend sein. Zur Nachhaltigkeit gehört auch, bestehende öffentliche Räume zu nutzen und Angebote in Wohnortnähe vorzuhalten – denn die Mobilität der Sportler hat den größten Impact, an dem man ansetzen kann. Und ich wiederhole mich gerne, es gilt dabei auch den „klassischen“ Vereinssport mit Wettkampf und Ligabetrieb im Blick zu haben, denn das ist ein Markenkern des Vereinssports.
Können Sie eine Sportanlage oder einen Typus nennen, die diese Kriterien erfüllt?
Der Sportpark Rems in Schorndorf ist eine solche Sportanlage, die auf knapp 100 000 Quadratmeter vieles vereint. Eine multifunktionale Sportanlage, die sowohl den „klassischen“ Vereinssport, als auch offene Bewegungsangebote vereint.
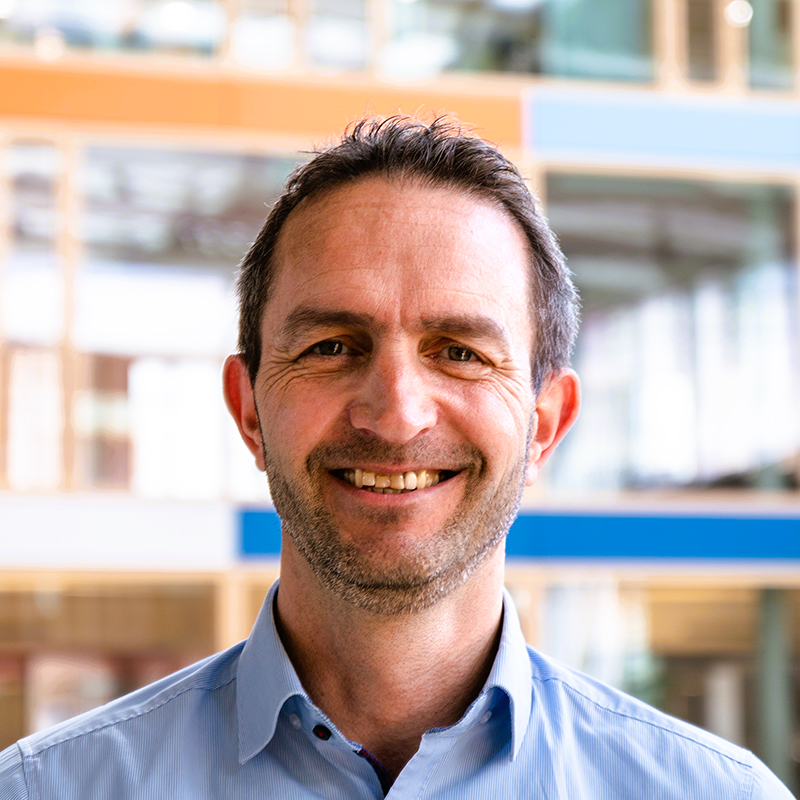
Stefan Anderer
Leiter des Geschäftsbereichs
Sport und Gesellschaft
Zur Person:
- Seit 2002 beim WLSB beschäftigt
- Seit 2009 Leiter des Geschäftsbereichs Sport und Gesellschaft (zuvor bei der Württembergischen Sportjugend tätig)
- Im Bereich Sport und Gesellschaft werden u. a. bearbeitet: Sport- und Vereinsentwicklung, Breitensport, Gesundheit, Integration, Inklusion